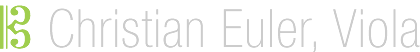»Von allen Instrumenten im Orchester ist die Viola dasjenige, dessen ausgezeichnete Eigenschaften man am längsten verkannt hat. Sie ist ebenso behende als die Violine, der Ton ihrer tiefen Saiten besitzt einen eigenthümlichen Anreiz, ihre hohen Töne schillern durch ihren traurig=leidenschaftlichen Ausdruck, und ihr Klangcharacter im Allgemeinen, von tiefer Schwermuth, scheidet sich von dem der anderen Streichinstrumente merklich ab. … War ein Musiker unfähig, den Violinposten schicklich zu bekleiden, so setzte er sich zur Viola. Daher kam es, daß die Violisten weder Violine noch Viola spielen konnten. Ich muß sogar gestehen, daß dieses Vorurtheil gegen die Violastimme auch in unserer Zeit nicht gänzlich erloschen ist, daß es in den besten Orchestern noch Violaspieler giebt, die so wenig die Viola wie die Violine zu behandeln wissen. Doch sieht man allerdings von Tag zu Tag mehr die Mißlichkeiten ein, die aus der Duldung solcher Leute entstehen, und so wird die Viola nach und nach wie die anderen Instrumente nur geschickten Händen anvertraut werden.«
Die prophetischen Worte des romantischen Feuerkopfes Hector Berlioz, der seinen bratschenden Harold auf italienische Abenteuerfahrt sandte, sollten sich eigentlich erst im 20. Jahrhundert erfüllen, als mit Lionel Tertis und William Primrose – für Christian Euler ist er neben Fritz Kreisler, Jascha Heifetz und Emanuel Feuermann der vierte im Streichquartett der persönlichen Heroen – zwei Meister ihres Faches auftraten, von denen starke inspirierende Kräfte und die Erkenntnis ausging, daß man nicht nur Menschen, sondern auch Instrumente nicht nach ihrem Äußeren vorverurteilen sollte. Rechnen wir zu diesen beiden überragenden Virtuosen noch den begeisterten Violaspieler Paul Hindemith als einen, der aus eigenster Betätigung genau wußte, daß man das Souterrain der Streicher weder mit dem Erdgeschoß noch dem Tiefparterre verwechseln dürfe; nehmen wir die bei uns immer noch unter ihrem Wert gehandelten Komponisten der britischen Insel wie William Bax, Arthur Bliss, William Walton und vor allem York Bowen, der die Bratschenliteratur quantitativ und qualitativ in ähnlicher Weise bereichert hat wie der elf Jahre jüngere Hindemith, dann kommen wir zu einer recht erklecklichen Zahl an Künstlern, die das Steuer zu Gunsten eines Instrumentes herumgerissen haben, über dessen Spieler vermutlich noch mehr Witze im Umlauf sind als man sie sich vom Kontrabaß, vom Schlagzeug und vom Horn erzählt.
Der Spott – oft genug das Resultat bitter-konkreter Wahrheiten, die dann jedoch aus Unkenntnis gewissermaßen perpetuiert und als Phrasen dahingetragen werden – löst sich überlicherweise in Momenten der Erkenntnis auf, die weder durch Predigten noch rationale Datenfülle zu erzwingen sind: Das Wort Richards von Schaukal, wonach man nur durch Gnade (sprich: Erleuchtung) ins Innere der Kunst gelange, gilt hier wie überall. Im richtigen Augenblick entsteht eine unerwartete Konstellation, trifft ein Ton sympathische Saiten, fällt ein Lichtkegel aus bislang nicht gekanntem Winkel auf einen möglicherweise längst bekannten Gegenstand – und mit einem Schlag erscheint, was bis dato »gewußt« schien, im äußersten Maße hinfällig. Und an die Stelle der Phrase tritt ein heftiges Interesse, das nichts sehnlicher will als das durch Schlagworte abgesperrte Vakuum zu füllen.
Natürlich wußte ich, wie sehr Wolfgang Amadeus Mozart die Bratsche geliebt, wie er sie trefflich eingesetzt und in seiner großen Sinfonia concertante Es-dur KV 364 mit Vehemenz gegen das Instrument des Vaters ins Feld geführt hat. Gewiß haben Robert Schumanns Märchenbilder op. 113 längst ihren Platz im Noten- und CD-Regal, und auch Paul Hindemiths rauhbeinige Knochenbrecher dürfen mitunter ihr halb-subversives Vergnügen verbreiten. Zu einem echten Einschwingvorgang, einem Einstimmen auf die Bratsche und ihre Besonderheiten kam es indessen nicht. Daß viereinhalb Stufen, sprich eine Quinte unter der G-Saite der Violine (wohin sich, wie ich heute ahne, Sergej Prokofieff sehnte, als er den Anfang seines Opus 63 komponierte), daß dort zwischen den samtig glühenden Regionen des Violoncellos und den strahlenden Kapazitäten der Teufelsgeige eine völlig eigene Welt, ein paralleles Universum vorzufinden ist: daß ging mir, ich gebe es unumwunden ohne jede Schamesröte zu, bei der intensiven Beschäftigung mit der Sonate von Sir Arnold Bax auf, die Christian Euler und Paul Rivinius für ihre Hommage an Lionel Tertis eingespielt haben. Konkreter gesagt: das Finale des Werkes, eine jener gewaltigen Schluß-Elegien, wie wir sie auch in verschiedenen Symphonien des Komponisten durchleben dürfen – dieses Molto lento entfaltete bei jedem neuen Durchgang neue emotionale Schichten und klangliche Ebenen, bis schließlich das Individuum völlig unverwechselbar vor mir stand und mich mit seiner eigenen Eloquenz regelrecht aufforderte, von gewesener Uneinsichtigkeit zu lassen.
So geschah es. Dem Lehrstück folgten bereichernde Begegnungen und Wiederbegegnungen. Floskeln wurden in dem Maße verdrängt, wie sich das Vakuum verlor. Bislang unbekannte Werke (noch einmal verweise ich auf York Bowen und seine fabelhaften Bratschenkompositionen, die mir Christian Euler nahebrachte), neue Kriterien des hörenden Mitempfindens, dadurch bedingt ein zunehmendes Differenzierungsvermögen auf einstigem Brachland – wenn das das Ergebnis einer einzigen Produktion ist, kann man vor derselben nur respektvoll die Kopfbedeckung lüften. Was ich hiermit und an dieser Stelle mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung tue …
Rasmus van Rijn
(XI/2013)